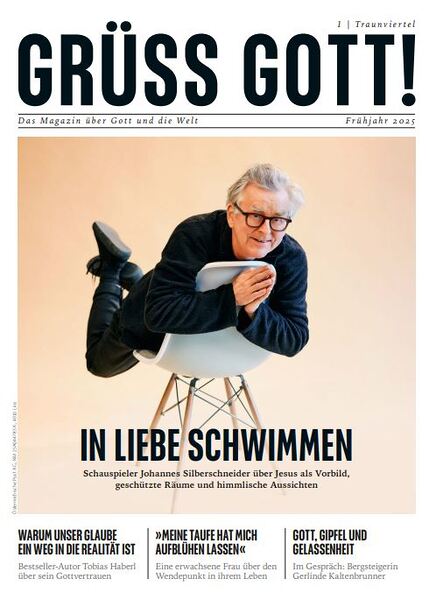Auferstehung: "Die Macht Gottes zur Neuschöpfung"
Die leibliche Auferstehung von den Toten gehört zu den zentralsten aber auch fantastischsten Glaubensinhalten des Christentums. "In seiner Allmacht wird Gott unserem Leib dann endgültig das unvergängliche Leben geben, indem er ihn kraft der Auferstehung Jesu wieder mit unserer Seele vereint" - so die im Katechismus der katholischen Kirche festgeschriebene Version. Die Salzburger Bibelwissenschaftlerin Marlis Gielen erklärt im "Kathpress"-Gespräche Entwicklung und Ausprägung des Auferstehungs-Glaubens anhand des biblischen Befundes.
"Ohne Judentum kein Christentum": Diese Prämisse gilt auch für den Glauben an Gottes Macht zur Neuschöpfung. Das, was die Auferstehung Jesu Christi qualifiziert, könne nur im Licht des alttestamentlich-frühjüdischen Glaubens an den einen Gott, der die gesamte Welt aus dem Nichts geschaffen hat und der Garant allen Lebens ist, erklärt und eingeordnet werden, so Gielen. Die konkrete Vorstellung einer allgemeinen Totenauferstehung habe sich als Konsequenz dieses Glaubens nach und nach im Laufe der Geschichte entwickelt.
In den Texten des Alten Testaments, die vor dem babylonischen Exil (6./5. Jahrhundert v. Chr.) entstanden sind, sucht man die Vorstellung einer Totenauferstehung noch vergeblich. Dort fristen die Toten vielmehr ein Schattendasein in der Unterwelt, der jüdischen Scheol, getrennt von Gott. "Die Heilshoffnung", erklärt die Bibelwissenschaftlerin, "ist zunächst also noch rein innerweltlich-diesseitig ausgerichtet und begrenzt".
Erst während beziehungsweise gegen Ende des Babylonischen Exils beginnt sich eine Auferstehungshoffnung zu entwickeln - zunächst noch auf das ganze Volk Israel, später dann auf das Individuum bezogen. Seine Geburtsstunde hatte der Glaube an die individuelle Auferstehung im 3./2. Jahrhundert vor Christus vor dem Hintergrund der heidnischen Fremdherrschaft.
Kennzeichnend für die damalige Weltsicht war zum einen, "dass die Geschichte schon bald in einem Katastrophenszenario enden wird, und zum anderen, dass der Gott Israels eine neue Welt schaffen wird", so die Bibelwissenschaftlerin. Die im Endgericht für gerecht befundenen Menschen haben dieser Vorstellung nach Anteil am neuen, unvergänglichen Leben, alle übrigen fallen dem endgültigen Tod anheim.
Ungeachtet einer gewissen Variationsbreite im Einzelnen finden sich diese Grundzüge einer Hoffnung auf Auferstehung in vielen alttestamentlichen und außerkanonisch-frühjüdischen Schriften zwischen dem 2. Jh v. und dem 1. Jh. n.Chr. Gielen verweist hier u.a. auf die Bücher Daniel, das zweite Makkabäerbuch oder die Psalmen Salomons.
Evangelien: Keine einheitliche Auferstehungs-Vorstellung
Mit Blick auf die Evangelien als Quelle für Zeit und Ort der Auferstehung gibt Gielen zu bedenken: "Das Neue Testament ist keine systematisch aufgebaute theologische Abhandlung, sondern vielmehr eine Bibliothek aus 27 Einzelschriften, die in einem Zeitraum von rund 100 Jahren entstanden ist." Dementsprechend ließen sich "Aussagen zur Erwartung der Auferstehung, die als solche in allen Schriften vorhanden sind, nicht Eins zu Eins harmonisieren".
Gielen verweist allerdings auf ein gemeinsames Grundverständnis: "Auferstehung verdankt sich dem auferweckenden Handeln Gottes, in dem seine Schöpfermacht zum Zuge kommt. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Auftakt zur allgemeinen Totenauferstehung am Ende der Zeiten." Und, so die Expertin: "Seine Auferweckungsexistenz ist das Modell für das, was die Toten dann erwartet."
Biblisches Menschenbild: Leibsein untrennbar mit Personalität verbunden
Die Betonung der leiblichen Auferstehung im Christentum hängt der Bibelwissenschaftlerin zu Folge mit dem biblischen Menschenbild zusammen. Dort gehöre das Leibsein des Menschen untrennbar zu seiner Personalität und Individualität. Allerdings bedeute leibliche Auferstehung nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes keineswegs eine Rückkehr in die irdische und damit per se vergängliche Leiblichkeit. Paulus bringe das klipp und klar auf den Punkt, so Gielen. "Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, und das Vergängliche wird nicht Unvergänglichkeit erben." Der von Gott geschenkte Auferstehungsleib zeichne sich vielmehr durch die in ihm "bewahrte Lebensgeschichte" des Geschöpfes aus.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema bleibe eine "besondere Herausforderung", die an die Grenzen der menschlichen Verständnis- und Sprachfähigkeit gebunden sei. Im sicheren Wissen um die eigene Sterblichkeit besitze sie zudem, so Gielen, "eine unaufhebbare existentielle Dimension".